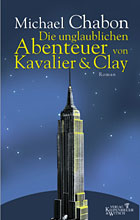
Michael Chabon:
Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier & Clay
Kiepenheuer & Witsch, 2002
Pulitzer Preis 2001 für Michael Chabons Kavalier & Clay
Die tragikomische Geschichte der beiden Cousins Josef und Sam, die Mitte des 20. Jahrhunderts dem Comic zu einem Siegeszug verhelfen, führt den Leser von Prag über New York bis in die Antarktis und wieder zurück.
New York 1939: Josef Kavalier, einem jungen jüdischen Zeichner und Entfesselungskünstler, gelingt die abenteuerliche Flucht aus dem besetzten Prag nach Brooklyn, wo er bei seiner Verwandtschaft Unterschlupf findet. Josef, der sich bald Joe nennt, kennt nur ein Ziel: Schnell an viel Geld zu kommen, um den anderen Mitgliedern seiner Familie, allen voran seinem Bruder Thomas, ebenfalls die Freiheit zu ermöglichen.
Gemeinsam mit seinem Vetter Sammy Clay versucht er, im neu entstehenden Comicgeschäft Fuß zu fassen, was ihnen alsbald auch gelingt. Ihr Superheld Der Eskapist, der die Träume, Ängste und Fantasien einer ganzen Generation junger Amerikaner verkörpert, zieht im Comic gegen Hitler in den Krieg und bringt seinen beiden Schöpfern den Ruhm und das Geld ein, das sie sich immer erhofft haben.
Durch den Erfolg geadelt, liegt ihnen bald die Künstlerwelt New Yorks zu Füßen – und Rosa Saks, die sich in Joe verliebt und die er heiraten möchte. Doch während der Eskapist aus jeder Episode als Sieger hervorgeht, drohen Joe und Sammy ihre privaten Kämpfe zu verlieren.
Michael Chabon beschreibt in einer poetischen Sprache die Erfolge und Niederlagen, die Sehnsüchte, Irrungen und Eskapaden zweier junger Männer, die den amerikanischen Traum verfolgen und dabei ihr Glück fast aus den Augen verlieren.
Rezensionen
„Völlig zu Recht wurde das erzählerische Virtuosenstück um „Kavalier & Clay“ im vergangenen Jahr mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Die größere Überraschung ist, dass sich die deutsche Übersetzung dem uramerikanischen Thema gewachsen zeigt.“
Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.8.2002
„Das ist auf 811 Seiten intelligente, hervorragend übersetzte und exzellent recherchierte Unterhaltung: Ein junger jüdischer Entfesselungskünstler flieht vor den Nazis aus Prag und wird in Amerika zum gefeierten Comiczeichner.“
Ismene Poulakos, Kölner Stadtanzeiger, 26./27.7.2003
Leseprobe
Salvador Dalí lag in der Mitte des Tanzsaalbodens auf dem Rücken, patschte hilflos mit seinen behandschuhten Händen auf den Helm seines Taucheranzugs. Seine Frau kniete neben ihm, bearbeitete grimmig eine Schraube, die den Helm mit dem Messingkragen des Anzugs verbolzte. Eine Ader auf ihrer Stirn war hervorgetreten. Ein schwerer Brocken aus schwarzem Onyx, den sie an einer dicken Goldkette trug, schlug immer wieder gegen die Glocke des Taucherhelms.
„Il devient bleu“, bemerkte sie mit ruhiger Panik. Zwei Gäste eilten an Dalís Seite. Einer von ihnen – es war der Komponist Scott – fegte die Hände der Señora Dalí fort und griff selbst zur Flügelmutter. Longman Harkoo durchmaß mit einer für einen Mann seiner Leibesfülle überraschenden Behändigkeit den Saal. Er trat mit der rechten Sandale gegen die ächzende Luftpumpe.
„Sie klemmt! Sie ist überlastet! Oh, was stimmt bloß nicht mit diesem Ding?“
„Er bekommt keinen Sauerstoff!“, vermutete jemand.
„Nehmt ihm den Helm ab!“, schlug ein anderer vor.
„Was glaubt ihr eigentlich, was ich hier versuche, verflucht noch mal!“, schrie der Komponist.
„Hört auf herumzuschreien!“, rief Harkoo. Er schob Scott zur Seite, ergriff die Flügelmutter mit seinen fleischigen Fingern und warf sich mit seiner ganzen Masse und Wucht in eine einzige gewaltige Drehung. Die Mutter bewegte sich. Er grinste. Die Mutter drehte sich wieder, und sein Grinsen verschwand. Die Mutter drehte sich immer und immer und immer wieder, ohne sich zu lösen; sie war mit der Schraube verschmolzen.
Joe stand neben Rosa im Türrahmen und schaute zu, und als sich die Mutter hilflos in den Fingern von Rosas Vaters drehte, griff sie mit beiden Händen nach Joes Arm, offenbar ohne zu bemerken, dass sie es tat, und drückte ihn. Dieses der Geste innewohnende Flehen um seine Hilfe erregte und alarmierte Joe. Er fasste in seine Tasche und holte das Victorinox-Messer hervor, das er von Thomas zum siebzehnten Geburtstag bekommen hatte.
„Was haben Sie vor?“, fragte sie und ließ ihn los.
Er antwortete nicht. Rasch durchquerte er den Raum und kniete sich neben Gala Dalí, deren Achselhöhlen seltsam nach Fenchelsamen rochen. Nachdem er sich versichert hatte, dass Salvador Dalí tatsächlich blau anlief, klappte Joe den Schraubenzieher des Taschenmessers heraus. Er drückte ihn in den Spalt der Schraube, damit sie sich nicht bewegte. Dann machte er sich an die Mutter. Durch das Drahtgitter der Sichtscheibe sah er Dalís Augen, die angstvoll, erstickend hervorquollen. Ein Schwall von unterdrücktem Spanisch schäumte gegen das zentimeterdicke Glas. Soweit Joe es beurteilen konnte – sein Spanisch war bescheiden -, rief Dalí elendig nach der Fürsprache der heiligen Muttergottes. Die Schraube hielt fest. Joe biss sich auf die Lippen und drehte, bis sich seine Finger anfühlten, als würden die Kuppen gespalten. Es gab ein Knacken, die Mutter protestierte und wurde wärmer. Dann gab sie langsam nach. Vierzehn Sekunden später riss Joe mit einem lauten Dom-Pérignon-Plopp den Helm ab.
Dalí gab ein laut schluchzendes Keuchen von sich, während man ihm aus dem Anzug half. New York war, wenn auch einträglich, in vielerlei Hinsicht ein gefährliches Pflaster für ihn: Im Frühjahr 1938 hatte er in allen Zeitungen gestanden, weil er bei Bonwit Teller in ein Schaufenster gefallen war. Ein Glas Wasser wurde gebracht; Dalí setzte sich auf und leerte es. Das linke Brachium seines berühmten Schnurrbartes war gewelkt. Er bat um eine Zigarette. Joe reichte ihm eine und hielt ihm einen Streichholz hin. Dalí sog den Rauch tief ein, hustete und zupfte sich einen Tabakkrümel von der Lippe. Dann nickte er Joe zu.
„Jeune homme, vous avez sauvé une vie de très grand valeur“, sagte er.
„Je le sais bien, maître“, entgegnete Joe.
Er fühlte eine schwere Hand auf seiner Schulter. Es war Longman Harkoo.
Strahlend wippte er in seinen Sandalen erfreut auf und ab über die Wendung, die die Dinge genommen hatten. Der Beinahe-Tod eines weltberühmten Malers bei einem Tauchunfall in einem Salon in Greenwich Village verlieh der Party einen unanfechtbaren surrealistischen Glanz.
„Heiße Sache“, sagte er.
Dann schloss die Party ihre Arme um Joe und hätschelte ihn. Er war ein Held. Menschen sammelten sich um ihn, warfen ihm Unmengen hyperbolischer Adjektive und ernster Vorhaltungen an den Kopf, reckten ihre blassen Blechgesichter zu ihm hoch, als wollten sie ein Zipfelchen seines glorreichen, klingelnden Hauptgewinns erhaschen. Sammy gelang es, sich durch die Leute zu drücken oder zu drängen, die Joe auf die Schulter klopften oder nach ihm griffen, und umarmte ihn. George Deasey brachte ihm etwas zu trinken, das in Joes Mund hell und kalt wie Metall schmeckte. Joe nickte langsam, ohne zu sprechen, nahm Anerkennung und Beifall mit der trägen, zerstreuten Art eines siegreichen Sportlers entgegen und atmete tief ein und aus. Es bedeutete ihm nichts: Lärm, Qualm, Gedränge, das Gemisch aus Parfüm und Haaröl, das schmerzhafte Pochen in seiner rechten Hand. Er sah sich um, erhob sich auf die Zehenspitzen, um über die gewachsten Köpfe der Männer zu blicken, spähte durch das dichte Laubwerk von Federn auf den Hüten der Frauen, suchte Rosa. Seine Selbstverleugnung, die eskapist-artige Reinheit seiner Absichten war vergessen im Rausch des Triumphs und dem Gefühl von Ruhe, das stark dem glich, das ihn nach einer Prügelei durchströmte. Es kam ihm vor, als sei sein Schicksal, sein Leben, der ganze Apparat seiner Selbstwahrnehmung nur auf die Frage gerichtet, was Rosa Saks nun von ihm denken mochte.
