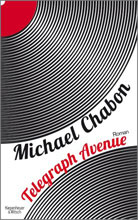
Michael Chabon:
Telegraph Avenue
Kiepenheuer & Witsch, 2014
Nat Jaffe und Archy Stallings führen gemeinsam den kleinen, aber exklusiv bestückten Jazzplattenladen Brokeland Records. Ihre Ehefrauen arbeiten gemeinsam als Hebammen. Der Ärger beginnt, als Gibson Goode, Footballlegende und fünftreichster Schwarzer Amerikas, gleich neben dem Plattenladen einen Megastore eröffnen will.
Brokeland Records scheint seltsam aus der Zeit gefallen: Menschen mit Muße und Geschmack treffen sich hier, um über Musik und Jazzlegenden zu fabulieren. Zu den ständigen Gästen gehört neben Jazzmusikern auch Chandler Flowers, Bestattungsunternehmer und Ratsmitglied. Eigentlich müsste er auf Nats und Archys Seite stehen, doch warum setzt er sich nicht für sie ein? Als wäre die Bedrohung seiner Existenz nicht schon genug, bekommt Archy auch noch privaten Ärger. Seine schwangere Frau Gwen findet heraus, dass er fremdgeht, sein abgehalfterter Vater will mal wieder Geld, und dann taucht auch noch ein Junge auf, der sein unehelicher Sohn sein könnte. Die resolute Gwen wiederum kämpft nach einer missglückten Hausgeburt, die sie mit Nats Frau Aviva begleitet hat, gegen arrogante Ärzte, hysterische Väter und überhaupt gegen die Umstände. Ihren Mann setzt sie kurzerhand vor die Tür. Doch wie soll es weitergehen auf der Telegraph Avenue?
Ein Roman, der sich einreiht in die großen Werke der amerikanischen Gegenwartsliteratur, eine Komposition, in der Jazz und Blues mitschwingt, ein großer Wurf des Pulitzer-Preisträgers Michael Chabon.
Auch als E-Book erhältlich
Rezensionen
„Die Übersetzerin Andrea Fischer kann man nur beglückwünschen zu ihrer Aufgabe – mehr Schwelgen im Vokabel- und Farbentopf ist nicht.“
Ulrich Rüdenauer, Süddeutsche Zeitung, 17./18.4.14
„Doch mit tiefer Zuneigung zur schwarzen Musik auf schwarzem Vinyl hält Chabon die Balance. Da zudem die Übersetzung von Andrea Fischer unaufdringlich Wege findet, die manchmal verwickelten Sprachbilder Chabons aufzudröseln, ist ‚Telegraph Avenue‘ ein reichhaltiges, deepes Lesevergnügen.“
Felix Bayer, Musikexpress, Mai 2014
„Und dann natürlich der ungeheuer humorvolle Stil, für dessen Übersetzung man Andrea Fischer ein extradickes Lob aussprechen möchte.“
Film, Sound and Media, Juli/August 2014
„Dieser Satz zeugt nicht nur von Chabons – von Andrea Fischer blendend ins Deutsche überführten – Sprachgefühl.“
Joachim Leitner, Tiroler Tageszeitung, 27.6.2014
„Voller Sprachwitz, der der Übersetzerin Andrea Fischer viel abverlangt und den sie wunderbar ins Deutsche transportiert hat.“
Gerrit Bartels, Tagesspiegel, 22.6.2014
„Ein langer, verzettelter, in jedes mögliche Detail eintauchender Roman, der trotzdem nie langweilig wird, stets gut unterhält und in seiner farbenfrohen, ekstatischen Sprache (von Andrea Fischer ins Deutsche übertragen) eine unschlagbare Stärke hat.“
buecherrezensionen. com, Marino Ferri, 15.4.2014
Leseprobe
Mondgesichtig, massig und mild bekifft stand Archy Stallings, ein Baby auf dem Arm, in einem rehbraunen Kordanzug und einem kürbisfarbenen Rollkragenpullover, der seine berüchtigte, aber nicht unvorteilhafte Ähnlichkeit mit Gamera betonte, der riesigen fliegenden Mutantenschildkröte aus dem japanischen Kino, hinter dem Verkaufstresen von Brokeland Records. Das Kind unter die linke Achsel geklemmt, arbeitete er sich mit der freien rechten Hand durch die achte von fünfzehn Kisten aus der Plattensammlung des verstorbenen Benezra, der genau wie Archy eine Vorliebe für fetten, fleischigen Jazz hatte, gepökelt und mit Funk durchwachsen. Electric Byrd (Blue Note, 1970). Johnny Hammond. Die ersten beiden Soloalben von Melvin Sparks. Charles Kynards Wa-Tu-Wa-Zui (Prestige, 1971). Während Archy den Nachlass in den Bestand von Brokeland aufnahm, lauschte er mit zeitweilig selig verdrehten Augen einer Platte aus der Sammlung des Toten, einer frischen Quadrofonieversion von Airto Moreiras Fingers (CTI, 1972), abgespielt auf der Quadaptor-Anlage des Ladens, einem niedlichen Gerät, das Nat Jaffe aus einem Müllcontainer gefischt und Archy, ehemaliger Elektriker für Armeehubschrauber mit einem 37,5-prozentigen Abschluss in Elektrotechnik an der San Franscisco State University, wieder fit gemacht hatte.
Die Kunst des einhändigen Katalogisierens: eine LP aus der Kiste zupfen, die Schutzhülle aus dem Cover kitzeln. Finger in die Hülle schieben. Die Platte mit den Fingerspitzen kellnergleich herausjonglieren, lediglich das Label berühren. Sie in einem bestimmten Winkel in das durchs Fenster fallende Morgenlicht halten. Dieses gleichmäßige, entlarvende East-Bay-Licht, streng und nachsichtig zugleich, das nur zu gerne die Wahrheit über den Zustand einer Platte verriet. (Obwohl Nat Jaffe behauptete, es liege nicht am Licht, sondern an der Fensterscheibe, einer großen, soliden Platte Pittsburgher Glases, die über einen Zeitraum von mehr als sechzig Jahren, in dem das aktuell Brokeland Records beherbergende Ladenlokal als Spencer’s Barber Shop firmierte, gelernte hatte, jede Form von Bullshit gnadenlos zu entlarven.)
Archy groovte mit geschlossenen Augen, wiegte sich zum Gewicht des Babys, zum fetten Duft von Ringo Thielmanns Bassline, zur Erinnerung an die himmelwärts verdrehten Augen von Elsabet Getachew, die ihm am Vortag im privaten Speiseraum des äthiopischen Restaurants Queen of Sheba einen geblasen hatte. Dachte an die Kettenbrückenkurve von Elsabets Oberlippe, an ihre Zungenspitze, die auf der E-Saite seines Schwanzes Addis Abeba spielte. Groovend, sich wiegend, genoss Archy den Samstagvormittag, bevor die Stiefel der Nachbarschaft schlechte Nachrichten durch die Ladentür tragen konnten; so hätte er den ganzen Tag weitermachen können, ewig.
„Armer Bob Benezra“, sagte Archy zu dem fremden Baby. „Hab ihn zwar nicht gekannt, aber er tut mir leid, so viele schöne Platten, wie er zurückgelassen hat. Deshalb bin ich Atheist, Rolando, wenn ich das ganze schöne Vinyl sehe, das der arme Kerl zurücklassen musste.“ Das Baby war nicht zu klein, um den Abgrund, die nackte Wahrheit, die harte Wirklichkeit von Leben und Tod kennenzulernen. „Was ist das für’n Himmel, wo man seine Platten nicht mitnehmen kann?“
Vielleicht wusste das Baby, dass die Frage rein rhetorisch gemeint war, denn es machte keinerlei Anstalten, sie zu beantworten.
