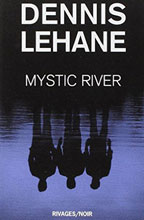
Dennis Lehane:
Mystic River (Spur der Wölfe)
Ullstein, 2003
Dave Boyle, Sean Devine und Jimmy Marcus verbrachten in den Flats von Boston eine ganz normale Kindheit – bis zu dem Tag, als Dave von Fremden in einem Wagen verschleppt wurde. Etwas Schreckliches passierte, das ihre Freundschaft beendete und die drei Jungen für immer veränderte.
Fünfundzwanzig Jahre später ist Sean Devine bei der Polizei, Jimmy Marcus ein Ex-Gauner mit einem kleinen Eckladen und Dave Boyle ein schwächlicher Mann, der versucht, seine Ehe zusammenzuhalten und seine Ängste nicht überhand nehmen zu lassen. Als Katie, Jimmys Tochter, ermordet aufgefunden wird, muss sich Sean um den Fall kümmern. Und er muss in eine Welt zurück, die er glaubte, längst hinter sich gelassen zu haben, eine Welt, in der die fast vergessenen Albträume der Vergangenheit auf ihn warten. Und während Sean versucht, den Fall zu lösen, geht Jimmy seiner eigenen Wege. In seinem blinden Zorn und seiner maßlosen Trauer will er eigenmächtig Rache nehmen – und steuer unaufhaltsam auf einen Abgrund zu.
Ein ungemein dichter und unglaublich unter die Haut gehender psychologischer Thriller über Liebe und Loyalität, Vertrauen und Familienbande – und Menschen, die mit de r dunklen Wahrheit ihrer gemeinsamen Vergangenheit klarkommen müssen.
verfilmt von Clint Eastwood mit Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne
Leseprobe
In dem Berg von Stummeln, die sich im Ascher angehäuft hatten, drückte die Mutter ihre Zigarette aus. Dabei entzündete sich jedoch eine andere, so dass eine Rauchfahne aufstieg und sich in Seans Nase stahl. Esther steckte sich sofort die nächste an, und Sean konnte sich sehr gut ihre Lunge vorstellen – knotig und schwarz wie Ebenholz.
„Brendan, wie alt sind Sie?“
„Neunzehn.“
„Und wann haben Sie die Highschool absolviert?“
„Absolviert“, wiederholte Esther verächtlich.
„Ich, ähm, hab letztes Jahr meinen Abschluss nachgeholt“, erwiderte Brendan.
„Also, Brendan“, sagte Whitey. „Sie haben also keine Ahnung, wo Katie am Freitagabend nach Ihrem Treffen im Hi-Fi hingegangen ist?“
„Nein“, antwortete Brendan, und das Wort erstarb ihm auf den Lippen, seine Augen wurden rot. „Sie hat sich ab und zu mit Bobby getroffen, aber der drehte ständig durch, weil er sich mit der Trennung nicht abfinden wolle. Katies Vater kann mich aus irgendeinem Grund nicht ab, deshalb mussten wir das mit uns geheim halten. Manchmal hat sie mir nicht erzählt, wo sie hinwollte, weil sie vielleicht Bobby traf, nehme ich an, um ihm klar zu machen, dass es aus war zwischen ihnen. Keine Ahnung. An dem Abend meinte sie nur, sie würde nach Hause gehen.“
„Jimmy Marcus kann Sie nicht leiden?“, fragte Sean. „Warum nicht?“
Brendan zuckte mit den Schultern. „Keinen blassen Schimmer. Aber er hat zu Katie gesagt, er will sie niemals mit mir zusammen sehen.“
„Was?“, rief seine Mutter. „Glaubt dieser Dieb, er wär was Besseres als wir?“
„Er ist kein Dieb“, entgegnete Brendan.
„Er war ein Dieb“, sagte die Mutter. „Das weißt du wohl nicht, du Klugscheißer, was? Er war früher so’n richtiger Dreckseinbrecher. Hat seine Tochter bestimmt von ihm geerbt. Die wär genauso schlimm geworden. Kannst von Glück sagen, Junge!“
Sean und Whitey warfen sich Blicke zu. Esther Harris war wohl die erbärmlichste Frau, die Sean je gesehen hatte. Sie war abgrundtief böse.
Brendan Harris öffnete den Mund und wollte etwas zu seiner Mutter sagen, schloss ihn aber wieder.
Whitey ergriff das Wort: „Katie hatte Prospekte von Las Vegas im Rucksack. Wir haben gehört, sie wollte dahin. Mit Ihnen, Brendan.“
„Wir …“ Brendan hielt den Kopf gesenkt. „Ja, wir wollten nach Vegas. Wir wollten heiraten. Heute.“ Er hob den Kopf, und Sean sah, das Brendan Tränen in den Augen standen. Brendan wischte sie mit dem Handrücken weg, bevor sie herunterkullern konnten, dann sagte er: „Ich meine, das hatten wir wenigstens vor.“
„Du wolltest abhauen?“, sagte Esther Harris. „Ohne ein Wort zu sagen?“
„Ma, ich …“
„Wie dein Vater? Ja? Mich mit deinem kleinen Bruder allein lassen, der das Maul nicht aufkriegt? Das hattest du vor, Brendan?“
„Mrs. Harris“, unterbrach Sean sie, „wenn wir uns bitte auf das dringliche Thema konzentrieren könnten. Brendan hat hinterher noch genügend Zeit, Ihnen alles zu erklären.“
Sie warf Sean einen Blick zu, den er bei vielen hartgesottenen Knackis und auch bei normalen Irren gesehen hatte, ein Blick, der besagte, er sei die Mühe zwar nicht wert, aber wenn er so weitermache, würde sie sich ihn so gründlich vorknöpfen, dass er hinterher blaue Flecke hätte.
Esther sah ihren Sohn an. „Das wolltest du mir antun? Hä?“
„Ma, hör zu …“
„Hör was? Was soll ich hören, hä? Was hab ich Schlimmes getan? Hä? Was hab ich getan, außer dich großgezogen, dich gefüttert und dir Weihnachten dieses Saxophon gekauft, das du nie gelernt hast? Das liegt immer noch im Schrank, Brendan.“
„Ma …“
„Nein, hol das mal raus! Zeig den Männern hier mal, wie toll du spielen kannst. Los, hol’s raus!“
Whitey sah aus, als könne er nicht glauben, was sich vor ihm abspielte.
„Mrs. Harris“, sagte er. „Das ist nicht notwendig.“
Sie zündete sich die nächste Zigarette an, das Streichholz zitterte vor Zorn. „Ich hab ihn immer gefüttert. Hab ihm Anziehsachen gekauft. Hab ihn großgezogen.“
„Ja, Ma`am“, antwortete Whitey, als die Eingangstür aufging und zwei Kinder mit Skateboards unter dem Arm hereinkamen, beide um die zwölf, dreizehn Jahre. Der eine war Brendan wie aus dem Gesicht geschnitten – genauso hübsch und mit dem gleichen dunklem Haar -, aber in seinen Augen hatte er dieselbe unheimliche Leere, die seine Mutter umgab.
„Hey!“, sagte der zweite Junge beim Betreten der Küche. Wie Brendans Bruder wirkte er klein für sein Alter, und er war mit einem langen, eingefallenen Gesicht gestraft, dem Gesicht eines hämischen alten Mannes auf dem Körper eines Kindes, das unter strähnigem Blondhaar hervorlugte.
Brendan Harris hob die Hand. „Hey, Johnny! Sergeant Powers, Trooper Devine, das ist mein Bruder Ray und das ist sein Freund Johnny O`Shea.“
„Hallo, Jungs!“, sagte Whitey.
„Hallo“, erwiderte Johnny O`Shea.
Ray nickte ihnen zu.
„Der kann nicht sprechen“, sagte die Mutter. „Sein Vater konnte das Maul nicht halten, und sein Sohn kriegt es nicht auf. Oh ja, das Leben ist gerecht.“
